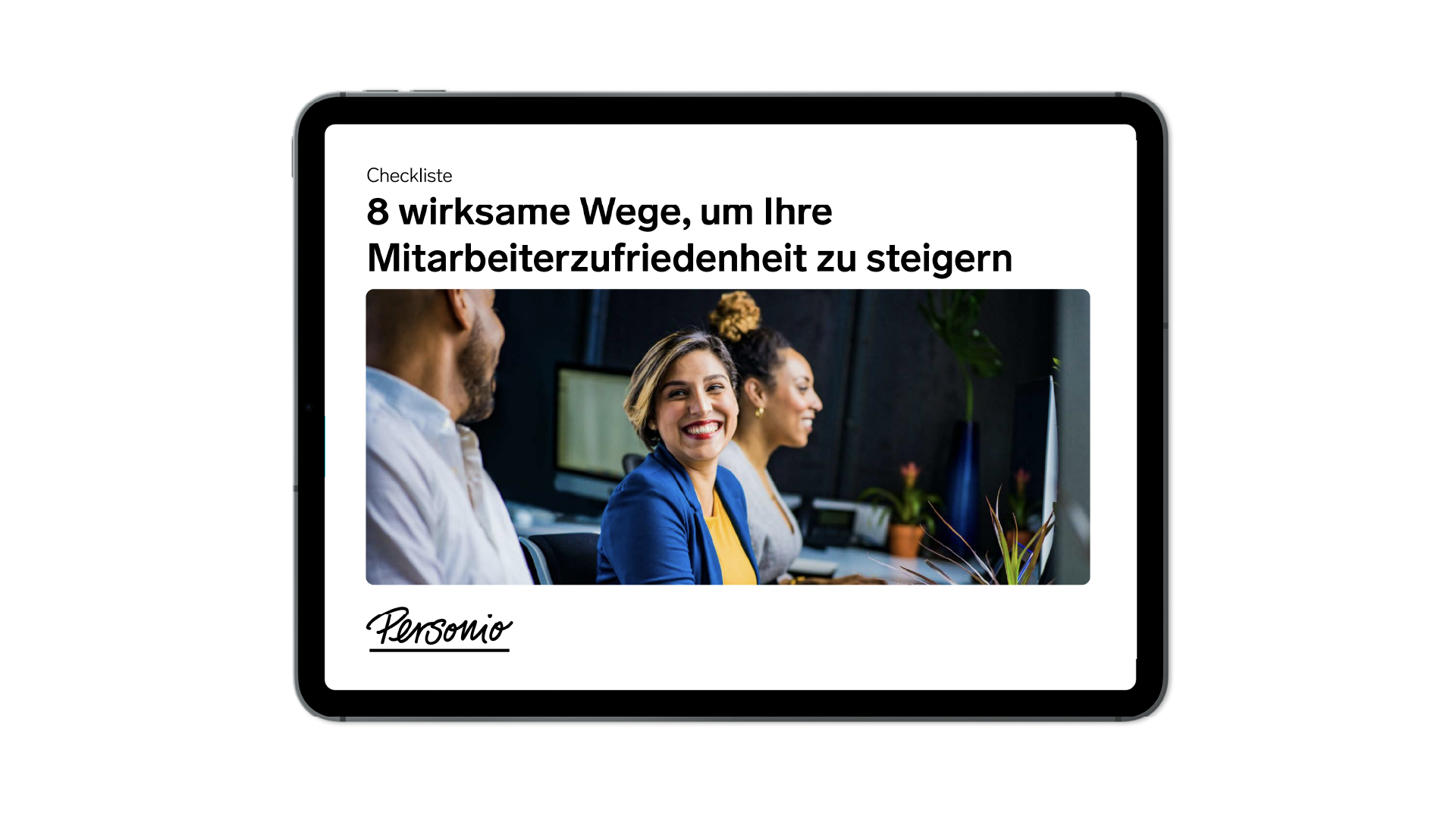Neueste Beiträge
5. August 2025
Mehr als Fürsorge: Wie mentale Gesundheit Ihr Unternehmen stärkt

Mentale Gesundheit ist längst kein Nischenthema mehr – sie ist zu einem zentralen Faktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg und eine gesunde Arbeitskultur geworden. Doch wie weit sind wir wirklich, wenn es um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz geht? Welche Herausforderungen bestehen weiterhin – und was können Unternehmen tun, um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden langfristig zu sichern?
Um diese Fragen zu beantworten haben wir mit Expertin Nora Dietrich gesprochen. Im Interview teilt sie ihre Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen, gibt praxisnahe Empfehlungen und spricht offen über blinde Flecken, notwendige Veränderungen und die Rolle von HR.
Schnuppert hier in Noras Buch "Mental Health at Work" hinein.Nora, du schreibst in deinem Buch viel über die steigende Bedeutung von psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst: Wo siehst du die größten Veränderungen – und wo hakt es trotz aller Diskussionen immer noch?
In den letzten Jahren ist mentale Gesundheit in der Mitte der Gesellschaft angekommen – auch im Arbeitskontext. Die Pandemie wirkte wie ein Evolutionsbeschleuniger: Wir alle saßen plötzlich im selben Boot, spürten Stress, Hilflosigkeit und Überforderung. Das hat das Bewusstsein geschärft, dass psychische Gesundheit ein zentraler Aspekt eines gesunden Lebens ist.
Heute setzen sich viele (ca. ein Viertel) Organisationen sichtbar für das Thema ein – mit Mental Health Days, Stressmanagement-Workshops oder Führungskräftetrainings. Das ist ein wichtiger Fortschritt.
Was sich jedoch noch nicht ausreichend verändert hat, ist der Blick aufs System. In meinem Buch Mental Health at Work beschreibe ich den notwendigen Perspektivwechsel: Weg vom rein individuellen Fokus hin zur systemischen Verantwortung. Noch immer gilt zu oft das Motto: „Wenn jede:r für sich sorgt, ist für alle gesorgt.“ Doch das greift zu kurz. Denn niemand kann unrealistische Workloads wegmeditieren. Gesundheit entsteht dort, wo auch Strukturen, Prozesse und Machtverhältnisse hinterfragt und verändert werden. Wir müssen anfangen, den Finger in die Wunde zu legen und fragen: Wo tragen wir zur Gesundheit bei? Und wo profitieren wir vielleicht heimlich davon?
Wo fehlt es im Arbeitskontext noch am stärksten am Bewusstsein für mentale Gesundheit und welche Rolle spielt sie für Mitarbeiterbindung und -gewinnung?
Ein großes Defizit sehe ich im Blue-Collar-Bereich – bei Mitarbeitenden in Produktion, Pflege oder Logistik. In Mental Health at Work spreche ich von einer „Zweiklassenprävention“: Während Wissensarbeitende oft Zugang zu flexiblen Lösungen und psychischen Gesundheitsangeboten haben, bleiben viele andere Gruppen außen vor.
Hinzu kommt die kulturelle Frage: Dürfen gesunde Entscheidungen im Alltag tatsächlich gelebt werden – oder scheitern sie an Zielvorgaben, Leistungsdruck oder fehlender Vorbildwirkung durch Führungskräfte? Viele Unternehmen stehen vor dem Dilemma: People oder Profit? Dabei zeigen Studien und Praxisbeispiele im Buch klar: Mentale Gesundheit ist kein Dekoartikel, sondern ein Wettbewerbsvorteil.
60 % der Beschäftigten würden heute für einen Job wechseln, der Gesundheit in den Mittelpunkt stellt – unter Führungskräften ist der Anteil sogar noch höher. Mentale Gesundheit wirkt also nicht nur präventiv, sondern ist auch ein zentraler Faktor für Mitarbeiterbindung, Arbeitgeberattraktivität und die Vermeidung von „Quiet Quitting“, das ganze Teams belasten kann. Organisationen, die mentale Gesundheit ernst nehmen, investieren in langfristige Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.
Worauf kommt es an, wenn man mentale Gesundheit strategisch und langfristig im Unternehmen verankern will?
In meinem Buch beschreibe ich ein 6-stufiges Strategie-Framework zur nachhaltigen Verankerung mentaler Gesundheit. Der erste Schritt beginnt ganz oben: Auf C-Level-Ebene braucht es echte Verantwortungsübernahme. Nur rund 10 % der Vorstände tragen explizit Gesundheitsverantwortung – dabei ist ihre Haltung entscheidend für Ressourcen, Priorisierung und Vorbildwirkung.
Dann braucht es Mental Health Governance: ein bereichsübergreifendes, diverses Team, das datengestützt arbeitet – denn Daten sind die Stimme der Mitarbeitenden. Sie zeigen: Wo fehlen Ressourcen? Wo entstehen Belastungen?
Maßnahmen sollten das ganze Spektrum abdecken – von Prävention über frühe Interventionen bis hin zur Begleitung bei schwerer Belastung oder Wiedereinstieg nach Krankheit. Das “BEM“, wenn es schon zu spät ist, reicht nicht.
Ein weiterer Schlüssel liegt im Work Design: Projektplanung, Rollenzuschnitte und KPIs müssen Gesundheit mitdenken. Und zuletzt braucht auch mentale Gesundheit eine gute Kommunikationsstrategie. Sichtbarkeit, Storytelling und Erfahrungsberichte machen Mut, die Stille zu durchbrechen.
Arbeit darf fordern, aber nicht krank machen
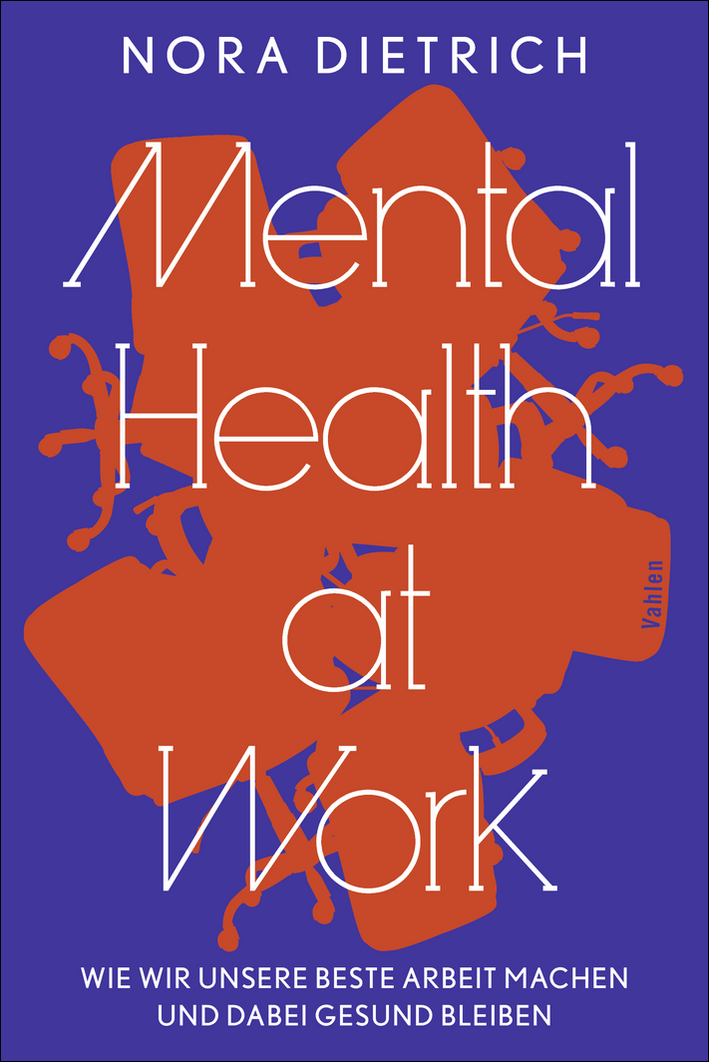
In „Mental Health at Work“ zeigt Nora Dietrich, wie Unternehmen mentale Gesundheit systematisch stärken können. Mit praxisnahen Beispielen und konkreten Handlungsempfehlungen räumt sie auf mit Mythen und Stigma. Ein Buch für alle, die Arbeitskultur neu denken und gesunde Teams wirklich leben wollen.
Jetzt auf Amazon bestellenWelche Empfehlungen gibst du HR-Fachkräften, um sich selbst nicht zu vernachlässigen?
Meine Lieblingsfrage lautet: Wer ist eigentlich HR für HR? Wer kümmert sich um diejenigen, die sich tagtäglich um alle anderen kümmern?
Viele HR-Profis arbeiten isoliert – in Ein-Frau-Teams, mit hohem emotionalem Aufwand und der ständigen Verantwortung, die Bedürfnisse anderer zu organisieren. Umso wichtiger ist es, einen stabilen sozialen Airbag zu haben: ein belastbares Netzwerk aus Kolleg:innen im eigenen oder anderen Unternehmen, persönliche Sparringspartner oder professionelle Unterstützung wie Coaches.
Gleichzeitig braucht es den Mut, selbst Grenzen zu setzen und sie auch offen zu kommunizieren: „Ich brauche hier Hilfe“, „Das übersteigt meine Kapazität.“ Viele HR-Kräfte übernehmen Aufgaben, für die sie nicht ausgebildet sind – und werden dabei oft nicht entsprechend gewürdigt. Sie gelten als selbstverständlich oder gar als Kostenstelle, obwohl HR einen enormen strategischen und kulturellen Beitrag leistet.
Daher mein Appell: Kümmert euch genauso gut um euch selbst wie um andere. Sucht euch Fortbildungen, tauscht euch aus, holt euch Feedback und gebt euch selbst die Erlaubnis, Unterstützung anzunehmen. Selbstfürsorge ist kein Egoismus – sie ist Grundvoraussetzung, um langfristig für andere da sein zu können.
Auf welche Symptome für Überlastung sollte man achten – und wie kann HR sie erkennen?
Stress hat viele Gesichter – körperlich, kognitiv und emotional. Viele Menschen spüren erste Warnsignale körperlich: Spannungsschmerzen, Kopfschmerzen oder schlechter Schlaf. Andere bemerken Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit oder ein diffuses Unsicherheitsgefühl. Auch emotionale Reaktionen können Hinweise sein – etwa erhöhte Reizbarkeit, ein stärkeres Bedürfnis nach Rückzug oder das Gefühl, ständig „näher am Wasser gebaut“ zu sein.
Typisch sind auch kompensatorische Verhaltensweisen: Überstunden, Perfektionismus, das Gefühl, ständig „die Kontrolle behalten“ zu müssen – all das kann Ausdruck innerer Überforderung sein.
Für HR oder Führungskräfte sind diese Warnsignale oft schwer zu erkennen, weil sie sich leise und individuell zeigen. Hinweise können sein: chronisch sinkende Teamleistung, auffällig viele Krankmeldungen in einzelnen Bereichen, gehäuftes kritisches Feedback zu einer Führungskraft oder verstärkte Rückzugs- oder Konflikttendenzen im Team.
Wichtig ist, diese Signale frühzeitig systematisch zu beobachten – nicht als Defizit, sondern als Zeichen eines Ressourcenmangels. Denn oft steckt hinter „Leistungsabfall“ schlicht eine schwindende psychische Belastbarkeit, die früh erkannt und adressiert werden kann.
Was macht eine gesunde Führungskultur aus – und wie können Führungskräfte konkret wirken?
Fühlen ist das neue Führen. Damit Gesundheit in Organisationen wirklich greifen kann, braucht es Führungskräfte, die nicht nur wirtschaftlich führen, sondern menschlich – und die die Erlaubnis haben, die Grenzen ihrer Teammitglieder zu respektieren. Nur in einer echten Vertrauenskultur dürfen Menschen auch mal sagen: „Ich kann nicht mehr – es ist zu viel.“
Gesunde Führung bedeutet deshalb vor allem: Vorleben. Denn bewusst oder unbewusst beobachten Mitarbeitende, was als „Karriererezept“ gilt. Wer als Führungskraft nachts um 23 Uhr noch E-Mails schreibt, sendet ein starkes Signal – selbst wenn es gut gemeint ist. Mitarbeitende mit weniger Entscheidungsmacht werden sich selten trauen, dem zu widersprechen.
In meinem Buch beschreibe ich drei zentrale Elemente gesunder Selbstführung bei Führungskräften:
Selbstreflexion: Wie arbeite ich eigentlich? Und wie prägt meine Lebens- und Führungsgeschichte meinen Stil?
Selbstoffenbarung: Wie offen bin ich im Umgang mit meiner eigenen mentalen Gesundheit – und schaffe ich damit Raum für Vertrauen?
Selbstführung: Wie gesund gestalte ich meinen Arbeitsalltag? Welche Grenzen ziehe ich – und lebe ich sie sichtbar?
Darauf aufbauend können Führungskräfte gesundheitsförderliche Rituale in den Arbeitsalltag integrieren: emotionale Check-ins vor Meetings, Teamcoachings, offene Gesprächsräume für Konflikte. So wird Gesundheit nicht zur Eskalationsstufe, sondern Teil einer emotional intelligenten Unternehmenskultur.
Was sollte sich im Umgang mit psychischer Gesundheit am dringendsten ändern?
Mein größter Wunsch ist: Wir müssen uns trauen, hinzuschauen. Es gibt längst wirksame Tools wie die Gefährdungsbeurteilung Psyche, die konkret zeigt, wo Belastungen entstehen und wie Organisationen gezielt gegensteuern können. Doch nur rund ein Viertel aller Unternehmen nutzt dieses Instrument – oft aus Unsicherheit oder aus Angst vor dem, was man herausfinden könnte.
Dabei beginnt Veränderung mit der Frage: Was braucht ihr – und was fehlt euch? Und auch: Wo passen unsere Entscheidungen eigentlich nicht zu dem, was wir nach außen versprechen? Nur wer bereit ist, ehrlich hinzusehen, kann echte Veränderung bewirken.
Gleichzeitig wünsche ich mir mehr Offenheit – nicht nur gegenüber Burnout oder Depressionen, über die mittlerweile häufiger gesprochen wird, sondern auch gegenüber Störungsbildern, die noch immer stark stigmatisiert sind: Suchterkrankungen, schizophrene Episoden oder bipolare Störungen. Es darf keine Hierarchie unter psychischen Erkrankungen geben.
Wir müssen verstehen: Jede:r Zweite wird im Laufe des Lebens eine psychische Erkrankung erleben. Es betrifft nicht „die anderen“. Es betrifft unsere Partner:innen, Kolleg:innen, Führungskräfte – und manchmal auch uns selbst. Mentale Gesundheit ist Teil von Leben und Arbeit – kein Ausnahmefall. Der größte Heilungshemmer bleibt oft die Angst vor dem Urteil anderer. Wenn wir diese Angst abbauen, gewinnen wir alle.

Nora Dietrich
Als Gründerin von Between People sowie Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und Organisationsentwicklerin setzt sich Nora dafür ein, dass mentale Gesundheit selbstverständlich wird und Menschen im Unternehmen an erster Stelle stehen. Ob inspirierende Keynote, Workshop oder strategische Beratung – Nora begleitet Organisationen auf dem Weg zu einer gesunden, zukunftsfähigen Arbeitswelt.
8 Inspirationen, um die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeitenden zu steigern